Heute ist Donnerstag, der 25.04.2024 |  Newsletter |
Newsletter |  Gewinnspiel
Gewinnspiel
 Newsletter |
Newsletter |  Gewinnspiel
Gewinnspiel
Glücksforschung im Aufwind
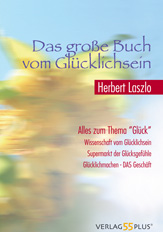 Das große Buch vom Glücklichsein auf der einen Seite und die Entwicklung der positiven Psychologie in den USA auf der anderen Seite haben der Glücksforschung in Österreich zu einem deutlichen Aufschwung verholfen. Sogar die Industriellenvereinigung hat das Glück als Standortvorteil Österreichs entdeckt und darüber in ihrem Höldrichsmühlen-Kreis diskutiert. Der Zukunftsforscher Horx hat sich ebenfalls dem Glück der Österreicher gewidmet.
Das große Buch vom Glücklichsein auf der einen Seite und die Entwicklung der positiven Psychologie in den USA auf der anderen Seite haben der Glücksforschung in Österreich zu einem deutlichen Aufschwung verholfen. Sogar die Industriellenvereinigung hat das Glück als Standortvorteil Österreichs entdeckt und darüber in ihrem Höldrichsmühlen-Kreis diskutiert. Der Zukunftsforscher Horx hat sich ebenfalls dem Glück der Österreicher gewidmet.Das bedeutet leider nicht, dass aus den Gegnern der Glücksforschung jetzt Befürworter geworden wären. Sie haben nur ihre Argumentation geändert. Anstatt wie bisher zu sagen: "Alles Unsinn", erklären sie jetzt: "Das sind doch Binsenweisheiten. Das wissen wir doch schon längst."
Die Situation erinnert an den legendären Apfel, den der britische Physiker Isaac Newton vom Baum fallen sah. Natürlich ist es eine Binsenweisheit, dass (und wie) etwas fällt, wenn man es loslässt. Aber erst wenn man daraus die nötigen Schlüsse zieht, entsteht eine neue Wissenschaft.
Wichtige Sätze, denen niemand widerspricht, weil sie ohnehin allgemeinen Beobachtungen entsprechen, bezeichnet man in der Wissenschaftstheorie als Axiome. Newtons Axiome haben in letzter Konsequenz einen Menschen auf den Mond und einen Roboter auf den Mars gebracht.
Und wie lauten die plötzlich unwidersprochenen Axiome der Glücksforschung?
1. Belastung, die der Belastbarkeit entspricht, ist angenehm.
2. Was angenehm ist, führt zum Wunsch nach Fortdauer.
Diese Axiome sind in der Arbeits- und Sportpsychologie unwidersprochenes Alltagswissen. Was bedeuten sie für die Glücksforschung? Zuerst einmal gar nichts. Sie sind wie große Steine, die auf einem Baugrund liegen. Wenn wir aber darauf Theorien bauen, dann stellen sie einen festen Untergrund dar. Dieser feste Untergrund hat bisher gerade in der Glücksforschung gefehlt.
Die Aussagen aus dem großen Buch vom Glücklichsein bleiben unverändert aufrecht:
- Wir können uns nicht selbst optimal belasten, sondern nur einander.
- Wer andere optimal belastet, also glücklich macht, kann damit nicht nur viel Geld verdienen, sondern auch Gegenleistungen erhalten, die man um Geld nicht kaufen kann.
- Wer hingegen über das nötige Kleingeld verfügt, kann sich im Supermarkt des Glücks in einem reichhaltigen Angebot bedienen.
Herbert Laszlo, Glücksforscher am Institut für Experimentelle Glücksforschung
 |
 |
 |
Landesmuseum, Mainz: Ausstellung Wasser im Spiegel der Kunst

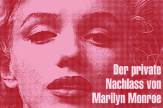




Das Landesmuseum in Mainz präsentiert Gemälde, die Wasser als Mittelpunkt der Malereien aufweisen.
Stadtgalerie, Klagenfurt: Ausstellung Brilliante Maler aus dem Teufelsmoor
Werke der Künstlerkolonie Worpswede zeigt die Stadtgalerie in Klagenfurt.
Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, Wien: Ausstellung Gips folgt SteinEine interessante Ausstellung der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künstler in Wien.
Novomatic Forum, Wien: Ausstellung Marilyn intimacy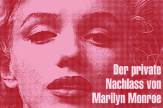
Der private Nachlass von Marilyn Monroe wird anlässlich einer Ausstellung im Novomatic Forum präsentiert.
Raimund Theater, Wien: Musik liegt in der Luft
Ein musikalischer Abend mit Sigrid Hauser & Viktor Gernot.
Theater in der Josefstadt, Wien: Kap HoornEin interessantes Stück mit bewundernswerten Schauspielern.
Kunsthalle, Bremen: Ausstellung Edvard Munch. Rätsel hinter der LeinwandDem Rätsel Edvard Munch auf die Schliche zu kommen, versucht die Kunsthalle Bremen in ihrer derzeitigen Ausstellung.
Albertina, Wien: Ausstellung René Magritte
Die Albertina zeigt Werke des belgischen Surrealisten René Magritte.
Tiroler Volkskunstmuseum, Innsbruck: Ausstellung Kommt und Schaut!
Krippenschauen im Tiroler Volkskunstmuseum.
Stadtmuseum, Kitzbühel: Ausstellung Hilde Goldschmidt und Friedrich Karl GotschEine interessante Schau um die Beziehung von Hilde Goldschmidt und Friedrich Karl Gotsch zeigt das Stadtmuseum Kitzbühel.
» Alle Einträge der Kategorie Archiv Jan-Feb 2012 »









